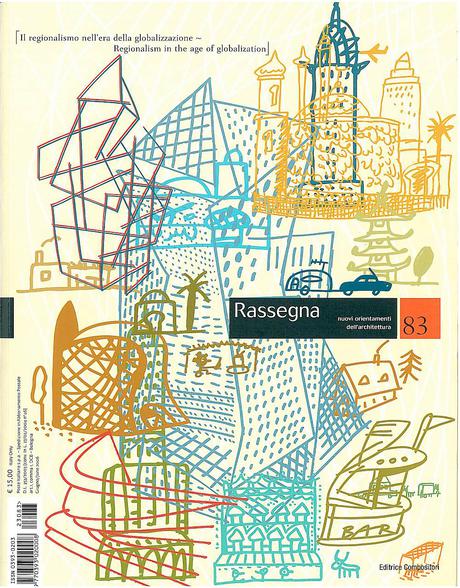Sieben Bilder zur Ökonomie der Aufmerksamkeit oder wie sich Ort und Welt gegenseitig nähren.
publ. Rassegna 85, Bologna 2006 (engl./ital.), Architektur Aktuell (dt./engl.), Wien 2007
Zum Haus Luzi von Peter Zumthor.
„ . . nämlich zu Haus ist der Geist
nicht am Anfang, nicht an der Quell. Ihn zehret die Heimat.
Kolonie liebt, und tapfer Vergessen der Geist.“
Friedrich Hölderlin
Kenneth Frampton strebte 1983 mit dem Begriff des Kritischen Regionalismus in seinem Essay „ Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architectural Resistance“1 nach einem reicheren Kontext für die moderne Architektur. Er beschreibt ihn in einem Interview2 nach wie vor als wichtige Haltung in der gestalterischen Praxis, warnt aber davor ihn als Stilbegriff misszuverstehen. Die Frage um das Verhältnis von Welt und Ort zeigt in der Geistesgeschichte Konstanz, auch wenn sich die Begriffe verschieben. Paul Ricoeur 1965 stellt „Universelle Zivilisation und Nationale Kulturen“ in eine dialogische Opposition, Martin Heidegger spricht 1951in „Bauen, Wohnen, Denken“ von Raum und Ort und bezieht sich dabei auf Friedrich Hölderlins „Kolonie und Heimat“.
Der folgende Essay umkreist dieses Begriffspaar anhand eines Gebäudes, einer Familie und eines Architekten aus Graubünden.
Erstes Bild – Das Tal
”Von da an verzettelt sich die Reise, die solange großzügig, in direkten Linien vonstatten ging. Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Orte Rorschach, auf schweizerischem Gebiet vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend besteigt, und in dem Augenblick, wo die kleine, aber offenbar ungewöhnlich zugkräftige Maschine sich in Bewegung setzt, beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt, ein jäher und zäher Aufstieg, der nicht enden zu wollen scheint. Denn Station Landquart liegt vergleichsweise noch in mäßiger Höhe; jetzt aber geht es auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge.”3
Thomas Mann führt Hans Castorp, die Titelfigur seines großen Romans ”Der Zauberberg” von Hamburg nach Davos. Eine Reise, die er 1912 selbst vollzog, als er seine dort stationierte, lungenkranke Frau Katia besuchte. Dabei passierte er auf halbem Weg zwischen Landquart und Davos das Graubündner Dörfchen Jenaz, in dem sich rund 90 Jahre später ein Agrarökonom und eine Handarbeitslehrerin ein Haus für sich und ihre sechs Kinder errichten sollten.
Zweites Bild – Das Haus
Das Haus Luzi steht am Rande des alten Dorfkerns, einem eng gedrängten Kreis von stämmigen Bauernhäusern, teils alte massive Holzhäuser in Blockbauweise, dunkel, fast schwarz verbrannt durch die Sonne von manchmal 300 Jahren.
Die Strasse vor dem Haus, fällt ab und hebt es auf einen Sockel aus sorgsam gefügtem Naturstein. Da hinein schiebt sich eine Garage, die mit dem Kellergeschoss verbunden ist. Drei volle Geschosse richten sich darüber auf: Ein gemeinsamer Eingang mit einer Einliegerwohnung, ein Wohngeschoss und ein Geschoss für die Schlafräume, das hoch durch einen offenen Dachraum überragt wird. Die Einliegerwohnung ist vermietet und soll später einmal dem Paar als Alterssitz dienen.
Aus dem Zugang, zum Dorfkern gerichtet und raumhoch verglast, taucht ein Gang tief in den geschlossenen Holzkörper hinein, um über eine einläufige Treppe in die eigentliche Wohnung der Familie zu führen. Wieder licht und frei zeigt sich dort das Entree als einer von vier gleichwertigen Räumen, das über Durchgänge mit der Küche, dem Essraum und einem Musikzimmer verbunden ist. Ein offener, fließender Raum zwischen fünf Holzkuben. In der Mitte befindet sich der Nassbereich, in den übrigen sind Nebenräume und vier Stiegenaufgänge ins Schlafgeschoss untergebracht.
Dazu bemerkt Peter Zumthor: “Da war eigentlich die Vorstellung, dass ich von der Stube oder vom Essraum direkt in mein Zimmer gehen kann, dass es für jeden einen eigenen und persönlichen Auf- und Abgang in das Zimmer gibt. Das ist ein Wohngefühl, eine Art Intimität, die ich da in den Bergen kennen gelernt habe. Vielleicht ist es diese „Ofentreppe“, die es früher gab, über die man direkt aus der Stube in die gewärmte Kammer über dem Stubenofen stieg, an die ich mich erinnere.”
Drittes Bild – Über das Haus
Peter Zumthor berichtet über zwei wesentliche Motivationen:
“Oben, nicht weit von dem Neubau weg, steht ein altes Schulhaus. Und dieses Schulhaus ist ein schöner, stattlicher, einfacher, simpler Strickbau. Und der wurde gebaut von einem der damals führenden Architekten im Kanton Graubünden. Von ihm stammen Hotelbauten in St. Moritz und Davos.
Das gehört sich, dass ein Architekt ganz einfache, simple Dinge machen kann. Und genau das wollte ich. Eine Aufgabe nehmen und etwas einfach und anständig erledigen. Und am liebsten in der Anonymität.
Das ist so ein persönlicher Antrieb.
Und das andere hat mehr zu tun mit der Konstruktion, mit den konstruktiven Beschränktheiten der Strickbauweise. Wenn man diese Bauweise anschaut, ist das wirklich archaisch. Wenn wie im 17. Jhdt. die Fenster in den Wandflächen noch klein sind, ist das stimmig, aber je größer die Fenster werden, umso mehr verliert der Strickbau an Kraft. Und da ist bei diesem Haus eine Antwort gefunden.“
Peter Zumthor löst dieses Paradox durch den Wechsel von massiven Ecktürmen und den vollständig verglasten Mittelfeldern. Sechs Meter breit öffnen sie sich mit Schiebetüren oder Drehtüren, auf tiefe wettergeschützte Terrassen und entsprechen so auch dem Wunsch der Bauherrn nach Licht und Raum.
Peter Zumthor: “Alle Räume sind wie im Kino und alle vier Ausblicke sind wunderschön. Da stört einfach nichts. Das ist selten. Das ist wie Cinemascope.”
Viertes Bild – Archaik und Verfremdungen
Es verwundert nicht, dass dieses Haus in dem kleinen Graubündner Dorf ambivalent aufgenommen wird. Vertraute archaische Grundmuster und Modernität scheinen sich daran gleichsam zu umkreisen.
Die doppelt symmetrische Form des Gebäudes baut auf einem Raster von zwei mal vier Wandscheiben und folgt der konstruktiven Logik einer traditionellen Bauweise. Die Raumbildung über Körper und Zwischenraum verweist auf ein Konzept der Moderne, das im Wohngeschoss kraftvoll spürbar bleibt. Durch die raffinierte Variation von nur wenigen Öffnungen verkehrt sich in den beiden anderen Geschossen der Raumeindruck völlig. Die Kraft der klaren, räumlichen Ordnung und die visuelle Dichte von Aussicht und Oberflächen bleibt ungerührt durch den alltäglichen Gebrauch. Es entsteht auch keine Rustikalität, denn die Raumhöhen folgen mit 2,5m heutigen Bedürfnissen. So erreichen auch die eigentlich üblichen drei Geschosse eine stattliche Höhe. Über einem offenen Dachraum sitzt hoch und frei tragend eine weit auskragende Hohlkastenkonstruktion, die sich in der Dachneigung am umliegenden Bestand orientiert. All dies bildet eine große Ordnung, denen durch leichte Asymmetrien das Zwanghafte genommen ist. Stolz steht es dort, wie auch Peter Zumthor konstatiert und entwickelt neben dem historischen Gewicht des alten Dorfkerns eine zumindest ebenbürtige Gravitation.
Fünftes Bild – Einem Haus auch Zeit lassen. Der Bau
Zu Beginn stand der Entschluss ein Haus aus massivem Holz zu bauen. Fichte für die Konstruktion und geölte Lärche für Fenster und Böden. Bäume wurden ausgesucht und das Holz im Winter eingeschlagen, aus hohen Lagen, daher engjährig und homogen. Erst dann machte man sich auf die Suche nach einem Planer. Eigentlich sollte es jemand aus dem Dorf sein, doch stieß man über eine Bekanntschaft auf Peter Zumthor aus dem nahe gelegenen Haldenstein. Die klaren Vorstellungen beiderseits passten zueinander. “Beide kamen zu mir” so Peter Zumthor “weil sie etwas wollten, das zu tun hat mit dieser Tradition des Ortes und der alten Bauweise, aber zeitgenössisch formuliert ist. Sie hatten keine formalen Vorstellungen, sondern Wertvorstellungen.” und “Wenn man sieht, was das bedeutet, wenn Leute in einer Kultur leben, sich in einer Kultur auskennen, und dann auch neue Leistungen abfragen bei einem Architekten, neue Leistungen abfragen mit einem Respekt für diese Kultur. Was will man mehr.”
Ungewöhnlich für die Arbeit mit Peter Zumthor, doch bezeichnend für das Projekt war der Wunsch der Bauherrn, einiges in Eigenleistung zu machen, doch man fand einen Modus und begann. Die Genehmigung durch die Gemeindebehörden erfolgte trotz enger Vorschriften mit Verständnis für die zeitgenössische Umsetzung, brachte aber auch die ersten Diskussionen mit Nachbarn und Dorfbewohnern. Nicht jedem “passte” es ins Dorf, und die Familie musste selbst einstehen für ihre Überzeugung ein Haus so zu bauen, wie es wirklich ist und nicht Bildern zu folgen. Mittlerweile ist es das Haus selbst und die ruhige Schönheit seines Inneren, das Skeptiker überzeugt – zumindest die meisten. Der Demontage eines 80 Jahre alten Bestands folgte im 2. Jahr der Bau des Kellers. Weitere zwei Jahre brauchte der Holzbau und der Ausbau im Inneren. Treppen und Badeinbauten wurden konsequent an den Wänden befestigt um die üblichen Setzungen zu ermöglichen. Vorgefertigte Boden-Wandelemente aus schwarz durchgefärbtem, geschliffenem Beton führen alle Wasseranschlüsse und erübrigen den Einsatz von Fliesen. Sie beeindrucken durch ihre Perfektion und noch viel mehr durch die Erklärung, dass die Familie sie selbst gegossen und poliert habe und die Steine dazu von einem nahe gelegenen, besonderen geologischen Verschneidungspunkt stammen. Aus einer Bachräumung habe man diese Gesteinsmischung geholt und deren Sieblinie für die Tauglichkeit im Beton überprüfen lassen.
Sechstes Bild – Auf der Walz
Eines Tags nahm Valentin Luzi auf dem Weg zur Arbeit einen Anhalter mit, einen reisenden Handwerksgesellen aus Heidelberg. Der gelernte Treppenbauer war auf der Suche nach einer neuen Stelle: Ob er Arbeit für ihn wüsste. Er blieb dann drei Monate im Hause der Luzi – solange, wie seine Zunftregeln es ihm erlaubten – baute Treppen und Böden ein und war auch sonst recht zu gebrauchen. Ein halbes Jahre später setzte er seine Arbeit fort und brachte einen ebenfalls wandernden Bootsbaugesellen aus der Lausitz mit, der aus einem gut abgelegenen Eichenstamm zwei Badewannen fertigte.
Knapp 1000 Gesellen sind zur Zeit in Europa “auf der Walz” und folgen damit einer mittelalterlichen Tradition, wonach sie nach Abschluss ihrer Lehrzeit in schwarze, “zünftige” Tracht gekleidet drei Jahre und einen Tag von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle reisen und in der Fremde weiter lernen. Vornehmlich in Deutschland, Frankreich, Dänemark und der Schweiz unterwegs hatte unser Bootsbauer auch schon in Argentinien und Sibirien als Zimmermann gearbeitet. Nie länger als drei Monate an einem Ort und nie näher als 50 km zum Heimatort sind sie mit minimalem Gepäck, ohne Mobilfunk unterwegs und einem Ehrenkodex verpflichtet. Was in Zeiten der totalen Telekommunikation und des kollektiven Konsumgenusses wie ein Anachronismus wirkt und in den 80er Jahren fast auszusterben drohte, lebt wieder auf.
Siebtes Bild – Über den Ort
Im Atelier von Peter Zumthor in Haldenstein: “Das was ich jetzt für die Familie Luzi gemacht habe, ist das, was ich eigentlich immer machen möchte: Eine Aufgabe ernst nehmen, einen Ort ernst nehmen und ein Gebäude hinstellen, das Freude macht und ein kleines Stück Bereicherung darstellt . Auf dieser Augenhöhe spielt das keine Rolle ob Welt oder Dorf. Das misst sich ja nicht an theoretischen Kriterien, sondern am Leben.“
„Ich begebe mich einerseits in den Ort hinein, spüre ihm nach, und gleichzeitig blicke ich nach außen, in die Welt meiner anderen Orte. Oder anders ausgedrückt: Es ist das dem Ort Fremde, das mir hilft, das dem Ort Eigentümliche neu zu sehen.“ 4
“Wenn ich die Menschen und mich selber richtig beobachte, dann brauchen die Menschen einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen. Sonst beginnen sie Kriege anzuzetteln. Das hilft sehr, dass Menschen einen solchen Ort haben. Und gleichzeitig ist es gut, wenn die Menschen möglichst viel von der Welt sehen und von der Welt wissen. Das ist eine alte Weisheit. In die Welt schauen, für das Verständnis und dann zu sehen, dass man einen eigenen Ort hat, um zu verstehen, dass andere Menschen ihren eigenen Ort haben müssen oder sollten.
Von da her greifen die beiden Schlagwörter Regionalismus und Globalisation zu kurz. Sie sind beide blind für das andere. Im Prinzip ist das eine dialektische Geschichte. Die Spannung des In-der-Welt-Seins baut sich auf aus diesem Mikro und Makro. Dem kleinen, Überschaubaren und dem Großen.“
Synopsis – Ökonomie der Aufmerksamkeit
Die vorangegangenen Skizzen beschreiben jeweils ein Verhältnis von Ort und Welt, und der Aufmerksamkeit, die beiden geschenkt wird:
Thomas Mann nutzt den Prätigau und Davos als pittoreske Kulisse, als allegorischen Szenenentwurf für eine metropolitane Gegenwelt. Das Haus Luzi selbst steht 250 Jahre nach Erfindung des Tourismus in der Schweiz, in einer alles andere als isolierten Tradition. Die Bauherrn beziehen die Ressourcen in einer eigenwilligen Balance von regionaler Verbundenheit und Weitblick aus der intensiven Auseinandersetzung mit dem Ort, mit den Potentialen der Umgebung.
So entstehen nicht nur technische Lösungen, sondern werden auch soziale Prozesse ausgelöst. All das, was Kultur über ihre Produkte hinaus bedeutet. Entsprechend wird ein solcher Bau auch zur Reflexion des Umfelds: Die Steine aus den nahen Bergen, die Bauweise von alten Häusern im Dorf. Die Fertigkeiten des lokalen Zimmermanns oder eines portugiesischen Maurers, der seit Jahren in der Region arbeitet. Nicht zuletzt trafen sie so auch auf Peter Zumthor, für den nicht ein schwer zu fassender Regionsbegriff im Vordergrund stand, sondern der Ort als Hier und Jetzt, als Fokus einer nachhaltigen Aufmerksamkeit und Summe von Beziehungen.
Im vierten Bild treffen wir schließlich auf eine alte, europäische Kultur des Lernens und des Austauschs, die Neugier, Fremde und die Geduld mit dem Ort vereint. 90 Tage mit einer handwerklichen Aufgabe zu verbringen, sich auf einen Ort einzulassen und dabei selbst reiche Erfahrungen einzubringen ist mehr als nur der Austausch von Produkten oder Informationen.
Globalisierung ist erst durch die Auflösung der Orte zu konkurrierenden Warenwelten, Bildern und Zeichen möglich geworden und bedeutet keinen territorialen Krieg, sondern die Konkurrenz um Aufmerksamkeit als knappes Gut. Wer seine Aufmerksamkeit fremden Bildern widme, wer in transnationale Konsumwelten entführt wird, geht dem eigenen Ort verloren.
Das Haus Luzi führt vor, wie Ort und Welt in einer Symbiose stehen, aber auch wie viel Kraft ein eigenes Zentrum braucht. Diese Kultur und die daraus entstehende Widerständigkeit sind wertvolle Ressourcen, die oft mit ihren Produkten verwechselt werden. Zugleich sind sie beispielhaft und auf diese Weise Konzept.
1) Kenneth Frampton in: Hal Foster (Hrsg.) “The anti-aesthetic: Essays on postmodern Culture”, New York 1993
2) Rassegna, Nr. 83, S. 9-19, Bologna 2006
3) Thomas Mann, „Der Zauberberg“ Frankfurt 2003
4) Peter Zumthor, Beitrag in: „Bau – Kultur – Region“ Bregenz 1996
Robert Fabach, Bregenz, 12. Mai 2006
Sieben Bilder zur Ökonomie der Aufmerksamkeit oder wie sich Ort und Welt gegenseitig nähren.
publ. Rassegna 85, Bologna 2006 (engl./ital.), Architektur Aktuell (dt./engl.), Wien 2007
Zum Haus Luzi von Peter Zumthor.
„ . . nämlich zu Haus ist der Geist
nicht am Anfang, nicht an der Quell. Ihn zehret die Heimat.
Kolonie liebt, und tapfer Vergessen der Geist.“
Friedrich Hölderlin
Kenneth Frampton strebte 1983 mit dem Begriff des Kritischen Regionalismus in seinem Essay „ Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architectural Resistance“1 nach einem reicheren Kontext für die moderne Architektur. Er beschreibt ihn in einem Interview2 nach wie vor als wichtige Haltung in der gestalterischen Praxis, warnt aber davor ihn als Stilbegriff misszuverstehen. Die Frage um das Verhältnis von Welt und Ort zeigt in der Geistesgeschichte Konstanz, auch wenn sich die Begriffe verschieben. Paul Ricoeur 1965 stellt „Universelle Zivilisation und Nationale Kulturen“ in eine dialogische Opposition, Martin Heidegger spricht 1951in „Bauen, Wohnen, Denken“ von Raum und Ort und bezieht sich dabei auf Friedrich Hölderlins „Kolonie und Heimat“.
Der folgende Essay umkreist dieses Begriffspaar anhand eines Gebäudes, einer Familie und eines Architekten aus Graubünden.
Erstes Bild – Das Tal
”Von da an verzettelt sich die Reise, die solange großzügig, in direkten Linien vonstatten ging. Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Orte Rorschach, auf schweizerischem Gebiet vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend besteigt, und in dem Augenblick, wo die kleine, aber offenbar ungewöhnlich zugkräftige Maschine sich in Bewegung setzt, beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt, ein jäher und zäher Aufstieg, der nicht enden zu wollen scheint. Denn Station Landquart liegt vergleichsweise noch in mäßiger Höhe; jetzt aber geht es auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge.”3
Thomas Mann führt Hans Castorp, die Titelfigur seines großen Romans ”Der Zauberberg” von Hamburg nach Davos. Eine Reise, die er 1912 selbst vollzog, als er seine dort stationierte, lungenkranke Frau Katia besuchte. Dabei passierte er auf halbem Weg zwischen Landquart und Davos das Graubündner Dörfchen Jenaz, in dem sich rund 90 Jahre später ein Agrarökonom und eine Handarbeitslehrerin ein Haus für sich und ihre sechs Kinder errichten sollten.
Zweites Bild – Das Haus
Das Haus Luzi steht am Rande des alten Dorfkerns, einem eng gedrängten Kreis von stämmigen Bauernhäusern, teils alte massive Holzhäuser in Blockbauweise, dunkel, fast schwarz verbrannt durch die Sonne von manchmal 300 Jahren.
Die Strasse vor dem Haus, fällt ab und hebt es auf einen Sockel aus sorgsam gefügtem Naturstein. Da hinein schiebt sich eine Garage, die mit dem Kellergeschoss verbunden ist. Drei volle Geschosse richten sich darüber auf: Ein gemeinsamer Eingang mit einer Einliegerwohnung, ein Wohngeschoss und ein Geschoss für die Schlafräume, das hoch durch einen offenen Dachraum überragt wird. Die Einliegerwohnung ist vermietet und soll später einmal dem Paar als Alterssitz dienen.
Aus dem Zugang, zum Dorfkern gerichtet und raumhoch verglast, taucht ein Gang tief in den geschlossenen Holzkörper hinein, um über eine einläufige Treppe in die eigentliche Wohnung der Familie zu führen. Wieder licht und frei zeigt sich dort das Entree als einer von vier gleichwertigen Räumen, das über Durchgänge mit der Küche, dem Essraum und einem Musikzimmer verbunden ist. Ein offener, fließender Raum zwischen fünf Holzkuben. In der Mitte befindet sich der Nassbereich, in den übrigen sind Nebenräume und vier Stiegenaufgänge ins Schlafgeschoss untergebracht.
Dazu bemerkt Peter Zumthor: “Da war eigentlich die Vorstellung, dass ich von der Stube oder vom Essraum direkt in mein Zimmer gehen kann, dass es für jeden einen eigenen und persönlichen Auf- und Abgang in das Zimmer gibt. Das ist ein Wohngefühl, eine Art Intimität, die ich da in den Bergen kennen gelernt habe. Vielleicht ist es diese „Ofentreppe“, die es früher gab, über die man direkt aus der Stube in die gewärmte Kammer über dem Stubenofen stieg, an die ich mich erinnere.”
Drittes Bild – Über das Haus
Peter Zumthor berichtet über zwei wesentliche Motivationen:
“Oben, nicht weit von dem Neubau weg, steht ein altes Schulhaus. Und dieses Schulhaus ist ein schöner, stattlicher, einfacher, simpler Strickbau. Und der wurde gebaut von einem der damals führenden Architekten im Kanton Graubünden. Von ihm stammen Hotelbauten in St. Moritz und Davos.
Das gehört sich, dass ein Architekt ganz einfache, simple Dinge machen kann. Und genau das wollte ich. Eine Aufgabe nehmen und etwas einfach und anständig erledigen. Und am liebsten in der Anonymität.
Das ist so ein persönlicher Antrieb.
Und das andere hat mehr zu tun mit der Konstruktion, mit den konstruktiven Beschränktheiten der Strickbauweise. Wenn man diese Bauweise anschaut, ist das wirklich archaisch. Wenn wie im 17. Jhdt. die Fenster in den Wandflächen noch klein sind, ist das stimmig, aber je größer die Fenster werden, umso mehr verliert der Strickbau an Kraft. Und da ist bei diesem Haus eine Antwort gefunden.“
Peter Zumthor löst dieses Paradox durch den Wechsel von massiven Ecktürmen und den vollständig verglasten Mittelfeldern. Sechs Meter breit öffnen sie sich mit Schiebetüren oder Drehtüren, auf tiefe wettergeschützte Terrassen und entsprechen so auch dem Wunsch der Bauherrn nach Licht und Raum.
Peter Zumthor: “Alle Räume sind wie im Kino und alle vier Ausblicke sind wunderschön. Da stört einfach nichts. Das ist selten. Das ist wie Cinemascope.”
Viertes Bild – Archaik und Verfremdungen
Es verwundert nicht, dass dieses Haus in dem kleinen Graubündner Dorf ambivalent aufgenommen wird. Vertraute archaische Grundmuster und Modernität scheinen sich daran gleichsam zu umkreisen.
Die doppelt symmetrische Form des Gebäudes baut auf einem Raster von zwei mal vier Wandscheiben und folgt der konstruktiven Logik einer traditionellen Bauweise. Die Raumbildung über Körper und Zwischenraum verweist auf ein Konzept der Moderne, das im Wohngeschoss kraftvoll spürbar bleibt. Durch die raffinierte Variation von nur wenigen Öffnungen verkehrt sich in den beiden anderen Geschossen der Raumeindruck völlig. Die Kraft der klaren, räumlichen Ordnung und die visuelle Dichte von Aussicht und Oberflächen bleibt ungerührt durch den alltäglichen Gebrauch. Es entsteht auch keine Rustikalität, denn die Raumhöhen folgen mit 2,5m heutigen Bedürfnissen. So erreichen auch die eigentlich üblichen drei Geschosse eine stattliche Höhe. Über einem offenen Dachraum sitzt hoch und frei tragend eine weit auskragende Hohlkastenkonstruktion, die sich in der Dachneigung am umliegenden Bestand orientiert. All dies bildet eine große Ordnung, denen durch leichte Asymmetrien das Zwanghafte genommen ist. Stolz steht es dort, wie auch Peter Zumthor konstatiert und entwickelt neben dem historischen Gewicht des alten Dorfkerns eine zumindest ebenbürtige Gravitation.
Fünftes Bild – Einem Haus auch Zeit lassen. Der Bau
Zu Beginn stand der Entschluss ein Haus aus massivem Holz zu bauen. Fichte für die Konstruktion und geölte Lärche für Fenster und Böden. Bäume wurden ausgesucht und das Holz im Winter eingeschlagen, aus hohen Lagen, daher engjährig und homogen. Erst dann machte man sich auf die Suche nach einem Planer. Eigentlich sollte es jemand aus dem Dorf sein, doch stieß man über eine Bekanntschaft auf Peter Zumthor aus dem nahe gelegenen Haldenstein. Die klaren Vorstellungen beiderseits passten zueinander. “Beide kamen zu mir” so Peter Zumthor “weil sie etwas wollten, das zu tun hat mit dieser Tradition des Ortes und der alten Bauweise, aber zeitgenössisch formuliert ist. Sie hatten keine formalen Vorstellungen, sondern Wertvorstellungen.” und “Wenn man sieht, was das bedeutet, wenn Leute in einer Kultur leben, sich in einer Kultur auskennen, und dann auch neue Leistungen abfragen bei einem Architekten, neue Leistungen abfragen mit einem Respekt für diese Kultur. Was will man mehr.”
Ungewöhnlich für die Arbeit mit Peter Zumthor, doch bezeichnend für das Projekt war der Wunsch der Bauherrn, einiges in Eigenleistung zu machen, doch man fand einen Modus und begann. Die Genehmigung durch die Gemeindebehörden erfolgte trotz enger Vorschriften mit Verständnis für die zeitgenössische Umsetzung, brachte aber auch die ersten Diskussionen mit Nachbarn und Dorfbewohnern. Nicht jedem “passte” es ins Dorf, und die Familie musste selbst einstehen für ihre Überzeugung ein Haus so zu bauen, wie es wirklich ist und nicht Bildern zu folgen. Mittlerweile ist es das Haus selbst und die ruhige Schönheit seines Inneren, das Skeptiker überzeugt – zumindest die meisten. Der Demontage eines 80 Jahre alten Bestands folgte im 2. Jahr der Bau des Kellers. Weitere zwei Jahre brauchte der Holzbau und der Ausbau im Inneren. Treppen und Badeinbauten wurden konsequent an den Wänden befestigt um die üblichen Setzungen zu ermöglichen. Vorgefertigte Boden-Wandelemente aus schwarz durchgefärbtem, geschliffenem Beton führen alle Wasseranschlüsse und erübrigen den Einsatz von Fliesen. Sie beeindrucken durch ihre Perfektion und noch viel mehr durch die Erklärung, dass die Familie sie selbst gegossen und poliert habe und die Steine dazu von einem nahe gelegenen, besonderen geologischen Verschneidungspunkt stammen. Aus einer Bachräumung habe man diese Gesteinsmischung geholt und deren Sieblinie für die Tauglichkeit im Beton überprüfen lassen.
Sechstes Bild – Auf der Walz
Eines Tags nahm Valentin Luzi auf dem Weg zur Arbeit einen Anhalter mit, einen reisenden Handwerksgesellen aus Heidelberg. Der gelernte Treppenbauer war auf der Suche nach einer neuen Stelle: Ob er Arbeit für ihn wüsste. Er blieb dann drei Monate im Hause der Luzi – solange, wie seine Zunftregeln es ihm erlaubten – baute Treppen und Böden ein und war auch sonst recht zu gebrauchen. Ein halbes Jahre später setzte er seine Arbeit fort und brachte einen ebenfalls wandernden Bootsbaugesellen aus der Lausitz mit, der aus einem gut abgelegenen Eichenstamm zwei Badewannen fertigte.
Knapp 1000 Gesellen sind zur Zeit in Europa “auf der Walz” und folgen damit einer mittelalterlichen Tradition, wonach sie nach Abschluss ihrer Lehrzeit in schwarze, “zünftige” Tracht gekleidet drei Jahre und einen Tag von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle reisen und in der Fremde weiter lernen. Vornehmlich in Deutschland, Frankreich, Dänemark und der Schweiz unterwegs hatte unser Bootsbauer auch schon in Argentinien und Sibirien als Zimmermann gearbeitet. Nie länger als drei Monate an einem Ort und nie näher als 50 km zum Heimatort sind sie mit minimalem Gepäck, ohne Mobilfunk unterwegs und einem Ehrenkodex verpflichtet. Was in Zeiten der totalen Telekommunikation und des kollektiven Konsumgenusses wie ein Anachronismus wirkt und in den 80er Jahren fast auszusterben drohte, lebt wieder auf.
Siebtes Bild – Über den Ort
Im Atelier von Peter Zumthor in Haldenstein: “Das was ich jetzt für die Familie Luzi gemacht habe, ist das, was ich eigentlich immer machen möchte: Eine Aufgabe ernst nehmen, einen Ort ernst nehmen und ein Gebäude hinstellen, das Freude macht und ein kleines Stück Bereicherung darstellt . Auf dieser Augenhöhe spielt das keine Rolle ob Welt oder Dorf. Das misst sich ja nicht an theoretischen Kriterien, sondern am Leben.“
„Ich begebe mich einerseits in den Ort hinein, spüre ihm nach, und gleichzeitig blicke ich nach außen, in die Welt meiner anderen Orte. Oder anders ausgedrückt: Es ist das dem Ort Fremde, das mir hilft, das dem Ort Eigentümliche neu zu sehen.“ 4
“Wenn ich die Menschen und mich selber richtig beobachte, dann brauchen die Menschen einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen. Sonst beginnen sie Kriege anzuzetteln. Das hilft sehr, dass Menschen einen solchen Ort haben. Und gleichzeitig ist es gut, wenn die Menschen möglichst viel von der Welt sehen und von der Welt wissen. Das ist eine alte Weisheit. In die Welt schauen, für das Verständnis und dann zu sehen, dass man einen eigenen Ort hat, um zu verstehen, dass andere Menschen ihren eigenen Ort haben müssen oder sollten.
Von da her greifen die beiden Schlagwörter Regionalismus und Globalisation zu kurz. Sie sind beide blind für das andere. Im Prinzip ist das eine dialektische Geschichte. Die Spannung des In-der-Welt-Seins baut sich auf aus diesem Mikro und Makro. Dem kleinen, Überschaubaren und dem Großen.“
Synopsis – Ökonomie der Aufmerksamkeit
Die vorangegangenen Skizzen beschreiben jeweils ein Verhältnis von Ort und Welt, und der Aufmerksamkeit, die beiden geschenkt wird:
Thomas Mann nutzt den Prätigau und Davos als pittoreske Kulisse, als allegorischen Szenenentwurf für eine metropolitane Gegenwelt. Das Haus Luzi selbst steht 250 Jahre nach Erfindung des Tourismus in der Schweiz, in einer alles andere als isolierten Tradition. Die Bauherrn beziehen die Ressourcen in einer eigenwilligen Balance von regionaler Verbundenheit und Weitblick aus der intensiven Auseinandersetzung mit dem Ort, mit den Potentialen der Umgebung.
So entstehen nicht nur technische Lösungen, sondern werden auch soziale Prozesse ausgelöst. All das, was Kultur über ihre Produkte hinaus bedeutet. Entsprechend wird ein solcher Bau auch zur Reflexion des Umfelds: Die Steine aus den nahen Bergen, die Bauweise von alten Häusern im Dorf. Die Fertigkeiten des lokalen Zimmermanns oder eines portugiesischen Maurers, der seit Jahren in der Region arbeitet. Nicht zuletzt trafen sie so auch auf Peter Zumthor, für den nicht ein schwer zu fassender Regionsbegriff im Vordergrund stand, sondern der Ort als Hier und Jetzt, als Fokus einer nachhaltigen Aufmerksamkeit und Summe von Beziehungen.
Im vierten Bild treffen wir schließlich auf eine alte, europäische Kultur des Lernens und des Austauschs, die Neugier, Fremde und die Geduld mit dem Ort vereint. 90 Tage mit einer handwerklichen Aufgabe zu verbringen, sich auf einen Ort einzulassen und dabei selbst reiche Erfahrungen einzubringen ist mehr als nur der Austausch von Produkten oder Informationen.
Globalisierung ist erst durch die Auflösung der Orte zu konkurrierenden Warenwelten, Bildern und Zeichen möglich geworden und bedeutet keinen territorialen Krieg, sondern die Konkurrenz um Aufmerksamkeit als knappes Gut. Wer seine Aufmerksamkeit fremden Bildern widme, wer in transnationale Konsumwelten entführt wird, geht dem eigenen Ort verloren.
Das Haus Luzi führt vor, wie Ort und Welt in einer Symbiose stehen, aber auch wie viel Kraft ein eigenes Zentrum braucht. Diese Kultur und die daraus entstehende Widerständigkeit sind wertvolle Ressourcen, die oft mit ihren Produkten verwechselt werden. Zugleich sind sie beispielhaft und auf diese Weise Konzept.
1) Kenneth Frampton in: Hal Foster (Hrsg.) “The anti-aesthetic: Essays on postmodern Culture”, New York 1993
2) Rassegna, Nr. 83, S. 9-19, Bologna 2006
3) Thomas Mann, „Der Zauberberg“ Frankfurt 2003
4) Peter Zumthor, Beitrag in: „Bau – Kultur – Region“ Bregenz 1996
Robert Fabach, Bregenz, 12. Mai 2006